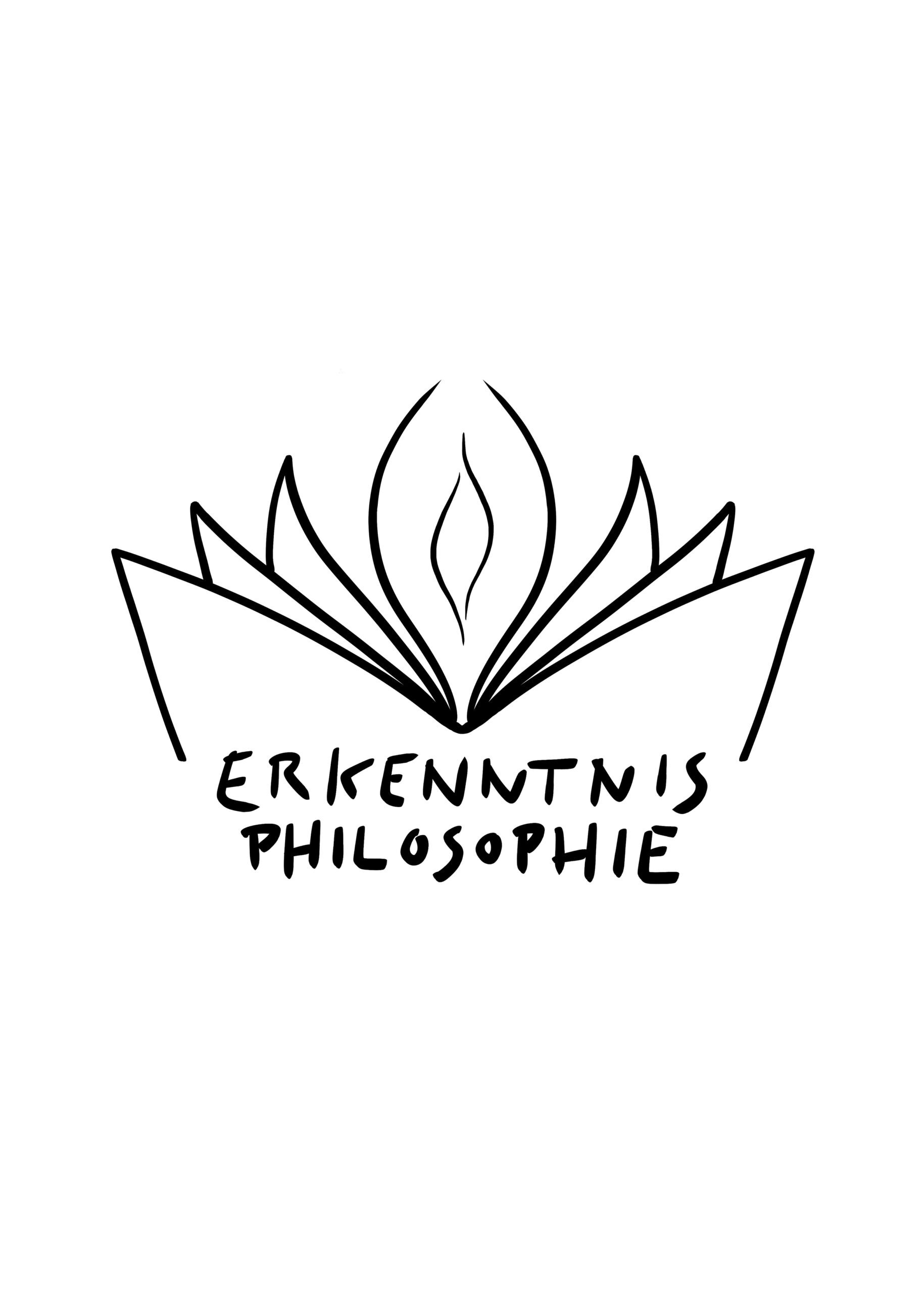Ein Gastbeitrag von Jean-Paul Kühne M.A.
Das gesellschaftliche Klima heute ist geprägt durch Defizite an kommunikativem Zusammenhalt und Unsicherheit in der persönlichen Orientierung. Daher ist es so wichtig wie überfällig, den Prozess des Gewinnens von Erkenntnissen von Neuem in die Hände des erkennenden Subjekts zu legen: Jeder Mensch kann Erkenntnis und Wahrheit erlangen, so die Erkenntnisphilosophie (Rainer Dyckerhoff, Erkenntnisphilosophie. Ein neuer und verständlicher Zugang zu Wirklichkeit und Wahrheit. München 2021).
Im Einzelnen: Die angeführten Defizite gefährden den kommunikativen Zusammenhang der Gesellschaft durch
- Propagieren „Alternativer Fakten“; man macht sich keine Mühe mehr, Lügen zu kaschieren
- Hass-Attacken einzig in der Absicht, Kontrahenten zum Schweigen zu bringen
- Täglich werden Untergangsszenarien als „unabwendbare“ Erkenntnisse präsentiert
- Die Natur wird zur bloßen Sache degradiert, ihr Subjektcharakter wird negiert (Klimakrise)
Werden die ersten Tatbestände mittlerweile eindeutig als Notstände registriert und diskutiert, gerät der letzte Aspekt eher zögernd ins Bewusstsein. Das liegt daran, dass das Verhältnis des Menschen zur Natur erst in den letzten Jahren als Kommunikationsgeschehen gewertet wird. Die Intention, der Natur, Pflanzen, Tieren eine Stimme zu geben, stimmt mit wesentlichen Aussagen der Erkenntnisphilosophie überein (Rainer Dyckerhoff, Erkenntnisphilosophie. München 2021, 86).
Auch eingedenk der oben genannten aktuellen Bedrohungen ist das Ziel „wirklichkeitsgemäßer Erfahrung und Erkenntnis“ (Dyckerhoff, 142) in der Philosophie keine wirklich neue Vorgabe. Im Gegenteil, es hat bis in unsere Tage eine Reihe von Vorkämpfern und Protagonisten, welche allerdings oft im Schatten einer „Mainstream-Philosophie“ standen und stehen (Dyckerhoff, 63).
Ein weiterer gemeinsamer Nenner realitätsbezogener Ansätze ist das deutliche Abstandnehmen von diskursdominierenden Definitionen und Begrifflichkeiten (Dyckerhoff, 56). Einer der Wegbereiter solcher Ansätze ist Martin Buber (1878–1965), der sich übrigens wiederholt, ähnlich wie auch die Erkenntnisphilosophie auf die Phänomenologie Edmund Husserls bezieht. Bekannt wurde Bubers Aussage:
„Ich habe keine Lehre. Ich zeige nur etwas. Ich zeige Wirklichkeit, ich zeige etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder zu wenig gesehen worden ist. Ich nehme ihn, der mir zuhört, an der Hand und führe ihn zum Fenster. Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus. Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.“
Martin Buber, Werke I. Schriften zur Philosophie, S. 1114 zitiert nach: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Da dieses Gespräch – soweit schriftlich fixiert – bislang überwiegend mit Partnern im akademischen Raum überliefert wurde, war die Durchschlagskraft dieser Einstellung darauf begrenzt.
Martin Bubers Dialogphilosophie orientiert sich an folgenden Kommunikationsformen des DU:
- Das (interpersonale) DU, der persönliche Dialog mit dem DU, dem menschlichen Gegenüber
Das DU im politisch-gesellschaftlichen Diskurs (DU im übertragenen Sinn) - Das DU in spiritueller (transzendenter) Dimension (Martin Buber, Ich und Du eBook 2023)
Ein, die gesamte Lebenswirklichkeit umfassender Dialog (vgl. Dyckerhoff 142) hat – mit einem anderen Wort – eine ökologische Dimension. Ökologie kommt von oikos (griech.): Haus-, Wirtschaftsgemeinschaft und bedeutet im erweiterten Sinn: Welt, Umwelt. Die Natur ist Teil meiner Umwelt. Auch mein Gesprächspartner ist Teil meiner Umwelt. Er ist meine und ich bin seine Umwelt. In der Konsequenz folgt daraus eine aus Kommunikations- und Sozialwissenschaft bestens bekannte Grundregel: Wer sich selbst ausnimmt aus Diagnose und Analyse zerstört den kommunikativen Zusammenhang der „Wahrnehmungs- und Erlebenswelt“ (Carl Rogers zit. na. Dyckerhoff, 116).
Die Dialogphilosophie Martin Bubers ruht sozusagen auf zwei Phänomenen, zwei Schultern, dem Ich und dem Du. Ich und Du attestieren sich gegenseitig „Evidenz“ als auch „Kohärenz“ (Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit). Diese machen den individuellen Erkenntnisprozess nicht überflüssig, Ich und Du gestehen sich im Dialog aber zumindest partiell Wahrheit zu. Dieser Prozess genauer betrachtet: Über „relative“ Begriffe, kristallisieren sich „individuelle“ Begriffe heraus, die ein höheres Mass an Erfahrung und Sich-hineinversetzen-können aufweisen. Erst diese „wirklichkeitsgemäßen“ und „in der Sache“ eindeutigen Begriffe, die nicht mehr an sinnliche Eindrücke gebunden sind, erlauben Wahrheitserfahrungen (vgl. Dyckerhoff, 78 ff.).
Dyckerhoff hält es sogar für möglich, dass solche Annäherungsprozesse von Erkenntnissen an die Wahrheit in einem Ergänzungsverhältnis zur gesellschaftlichen Diskurstheorie der Frankfurter Schule stehen (Dyckerhoff, 126). Auch in meinem Blog mb-today habe ich unter den Überschriften „Anders lernen, ausgelöst durch eine andere Frankfurter Schule“ vom 30.03.2024 sowie „Was in den Moseskorb passt. Buber meets Kluge“ vom 03.02.2024 auf diesen Aspekt einer Übereinstimmung mit Martin Buber hingewiesen. Das Gespräch mit dem DU beginnt allerdings schon viel umfassender und viel früher, nämlich im „vorsprachlichen“ Dialog (vgl. Dyckerhoff, 33).
Wie schon gesagt, Buber hat sich eingemischt, ist selten einer Diskussion, einer Auseinandersetzung ausgewichen. Gespräch bei Buber meint in erster Linie die mündliche Form, auch wenn überwiegend die schriftliche überliefert ist (Martin Buber, Das Wort, das gesprochen wird (Audio) YouTube, 2012).
Vor allem aber: Buber hat standgehalten, buchstäblich bis zum letzten Moment. Auch als ihm die Professur aberkannt wurde und er zwischen ‘33 und ’38 nurmehr das jüdische Lehrhaus betreute. Den Dialog nahm er wenige Jahre nach dem Krieg, so mit Heidegger, wieder auf.
Bubers Obsession für den Dialog lasst ihn vornehmlich situationsbezogen agieren und reagieren. Will man der Breite seiner Themen nur ansatzweise gerecht werden, ergibt sich in der Darstellung eine gewisse Gewichtung zu Gunsten des breit Darstellenden, des Narrativen, genannt seien nur die von Buber gesammelten ‘Chassidischen Legenden‘ (vgl. dazu https://mb-today.de). Buber ließe sich auch ‚Philosoph des Weges‘ nennen. Aus diesem Erzähl- und Darstellungsfluss blitzen dann jeweils spontane Heureka-Erkenntnisse auf.