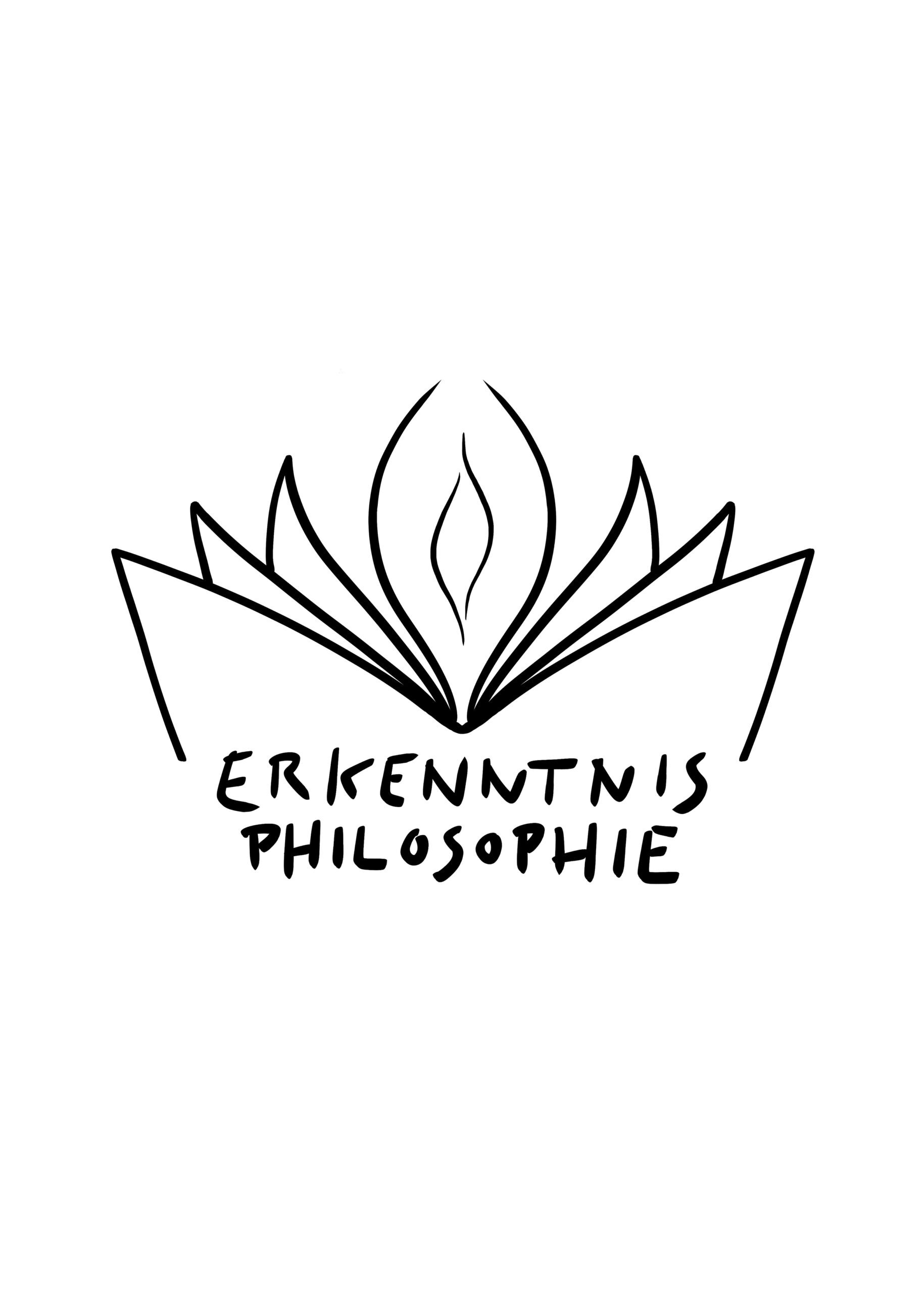Erkenntnisphilosophie ist keine Theorie,
ist nicht Erkenntnistheorie
I.
Dieses Buch ist insbesondere geboren aus kritischer Sicht auf die unbefriedigende Situation der Philosophie gerade bei ihrer eigentlichen Grundthematik: Erkenntnis. Denn da gibt es seit jeher nur die vielen verschiedenen und auch widersprüchlichen Theoriekonstrukte, die in der Regel sehr umfangreich und kompliziert bis abstrakt sind.
Eine Philosophie der Erkenntnis aber braucht vorab keine “metaphysische“ Paragraphen, wie Immanuel Kant sie seiner “Kritik der reinen Vernunft“ voranstellte, um auf dieser theoretischen Basis sein Werk aufzubauen. Kants Art von Philosophie wurde später “transzendentaler Idealismus“ genannt, ist also eine der vielen unterschiedlichen theoretischen Kategorien der Philosophie.
Ebensowenig braucht die Erkenntnisphilosophie vorab komplexe theoretische “logische Untersuchungen“, wie Edmund Husserl sie seiner phänomenologischen Erkenntnistheorie voranstellte. – Husserls Bemühen um eine “phänomenologische“ Neubegründung der Philosophie an der Wende zum 20. Jhdt. muss allerdings ausdrücklich gewürdigt werden! Von seinem ernsthaften Ringen um die Sache zeugt sein philosophischer Nachlass von ca. 40 000 handgeschriebenen Seiten. Dabei ist nicht zu übersehen, dass Husserls „transzendentale Phänomenologie“ noch stark in der Tradition von Kant verläuft; die philosophischen Rezeptionen bzw. Interpretationen sind recht unterschiedlich: es gibt Lesarten als „phänomenologischer Subjektivismus“ (insofern ein Bezug zur Wirklichkeit der Welt methodisch zunächst „eingeklammert“ wird oder auch gar nicht als möglich bzw. erstrebens-wert erscheint), als „phänomenologischer Konstruktivismus“ (im Zusammenhang mit der sog. „phänomenologischen Gegenstands-Konstitution“) und als „phänomenologischer Idealismus“ (bei Betonung der „eidetischen Reduktion“ mit dem Ziel einer „phänomenologischen Wesensschau“). – Durch Martin Heidegger erfuhr die Phänomenologie anschließend die erste entscheidende Weiterentwicklung, und sie präsentiert sich heute in weiterhin aktualisierten verschiedenen Varianten.
II.
Erkenntnisphilosophie ist nicht eine (weitere) Theorie oder Spekulation über etwas Rätselhaftes oder Unbekanntes; vielmehr leistet sie eine unmittelbare phänomenologische Beschreibung der Erkenntnisfähigkeit selbst; oder anders ausgedrückt: sie stellt die phänomenologisch-unmittelbar erfasste Tatsache unserer menschlichen Erkenntnisfähigkeit dar. Insbesondere beschreibt sie zunächst Aspekte, Zusammenhänge und den Charakter der beiden angeborenen menschlichen Grundfähigkeiten, auf denen unsere Erkenntnisfähigkeit letztlich beruht, nämlich der #Wahrnehmungsfähigkeit (mit allen Sinnen) und der #Denkfähigkeit (einschließlich Gedächtnis).
III.
In diesem Zugang zur Erkenntnisfähigkeit sind die üblichen Widersprüche von klassischen philosophischen Theorien wie z.B. “Empirismus“, “Rationalismus“ und “Idealismus“ überwunden, denn hier kommen diese Aspekte alle an ihrem je berechtigten Platz in ihrer jeweils originär-eigenständigen Qualität zur Geltung.
In der klassischen Philosophie bestehen solche unterschiedlichen philosophischen Kategorien nebeneinander als sozusagen aufgeblähte Ismus-Ideologien, die jeweils einen Aspekt hervorheben und ihn in einseitiger Weise überbetonen; ihre Begründer gehen dabei von je verschiedenen (geistigen) Fähigkeiten und Bewusstseinsaspekten aus, die bezüglich der Erkenntnisthematik aufzufinden sind bzw. an ihr beteiligt zu sein scheinen. Bei dieser Vorgehensweise wundert es dann allerdings nicht, dass solche Ismus-Theorien in der Regel als unvereinbar erscheinen bzw. widersprüchlich sind und sich gegenseitig ausschließen, dass folglich je nach persönlicher Denkweise, Vorliebe oder Absicht der eine auf dieses, der andere auf jenes Pferd setzt, – und dass all das potentiell endlos diskutiert werden kann.
In der mit diesem Buch vorliegenden Darstellung unserer Erkenntnisfähigkeit werden die verschiedenen Aspekte bzw. Qualitäten an ihrem je berechtigten Platz gesehen und beschrieben, ihr Zusammenspiel wird dargestellt, und so zeigt sich, wie sie gemeinsam in Kohärenz uns Erkenntnis ermöglichen:
Das sensorisch basierte Empirische kommt durch unsere Wahrnehmungsfähigkeit ins Spiel und zur Geltung: Immer ist die “Erfassung von Sinnesdaten“ – und zwar in der Gestalt wahrgenommener Phänomene – der ursprüngliche Input für alle unsere Erkenntnisleistungen und schließlich auch ganz real für den praktischen Umgang mit den Dingen.
Das Rationale kommt in unserer Denkfähigkeit zum Ausdruck – unserer zweiten Grundfähigkeit zur Erlangung von Erkenntnis, gemeinhin genannt „Verstand“. Das Rationale zeigt sich konkret im logischen Umgang unseres Denkens mit den wahrgenommenen Phänomenen, und zwar indem es zum Verständnis von Zusammenhängen dieser Phänomene führt. Bezieht sich unser Verstand durch seine Tätigkeit erfolgreich und auch praktisch auf das Unbedingte der Wirklichkeit, so können wir dann auch von „Vernunft“ sprechen. – Das berührt schon den nächsten Punkt:
Das Ideelle schließlich zeigt sich – zunächst ganz allgemein gesagt – im Streben unserer Erkenntnisfähigkeit nach Wahrheit; d.h. genauer: das Ideelle zeigt sich darin, dass wir mit unserer Erkenntnisfähigkeit letztlich auch das jeweilige Wesen bzw. die Idee von den konkreten Dingen und Geschehnissen erfassen und verstehen können (bei anspruchsvollen Dingen und Themen gelingt das nur, wenn wir uns wirklich ernsthaft für sie interessieren). Oder noch anders ausgedrückt: Das Ideelle zeigt sich in unserer Fähigkeit zur Erkenntnis der den jeweiligen Phänomenen zugrunde liegenden Wirklichkeit, und zwar konkret in wirklichkeitsgemäßen Begriffen von den jeweiligen Phänomenen, Dingen, Geschehnissen.
IV.
Die beiden Grundfähigkeiten zur Gewinnung von Erkenntnis, Wahrnehmung und Denken, werden im Buch zunächst jeweils für sich eigenständig analysiert und beschrieben bzw. charakterisiert (Kap. 2 und 3). Daraufhin wird automatisch sichtbar, wie die Interaktion dieser beiden grundverschiedenen Fähigkeiten zu einer Synthesis führt, nämlich zu Erkenntnis. Insbesondere wird sichtbar, dass und wie das #Denken mit den Inhalten bzw. Phänomenen unserer #Sinneswahrnehmungsfähigkeit umgeht, wie auf diese Weise die #Bildung von Begriffen dieser Phänomene geschieht, und wie uns auf Basis von Begriffen schließlich Erkenntnis möglich wird (Kap. 4 und 5).