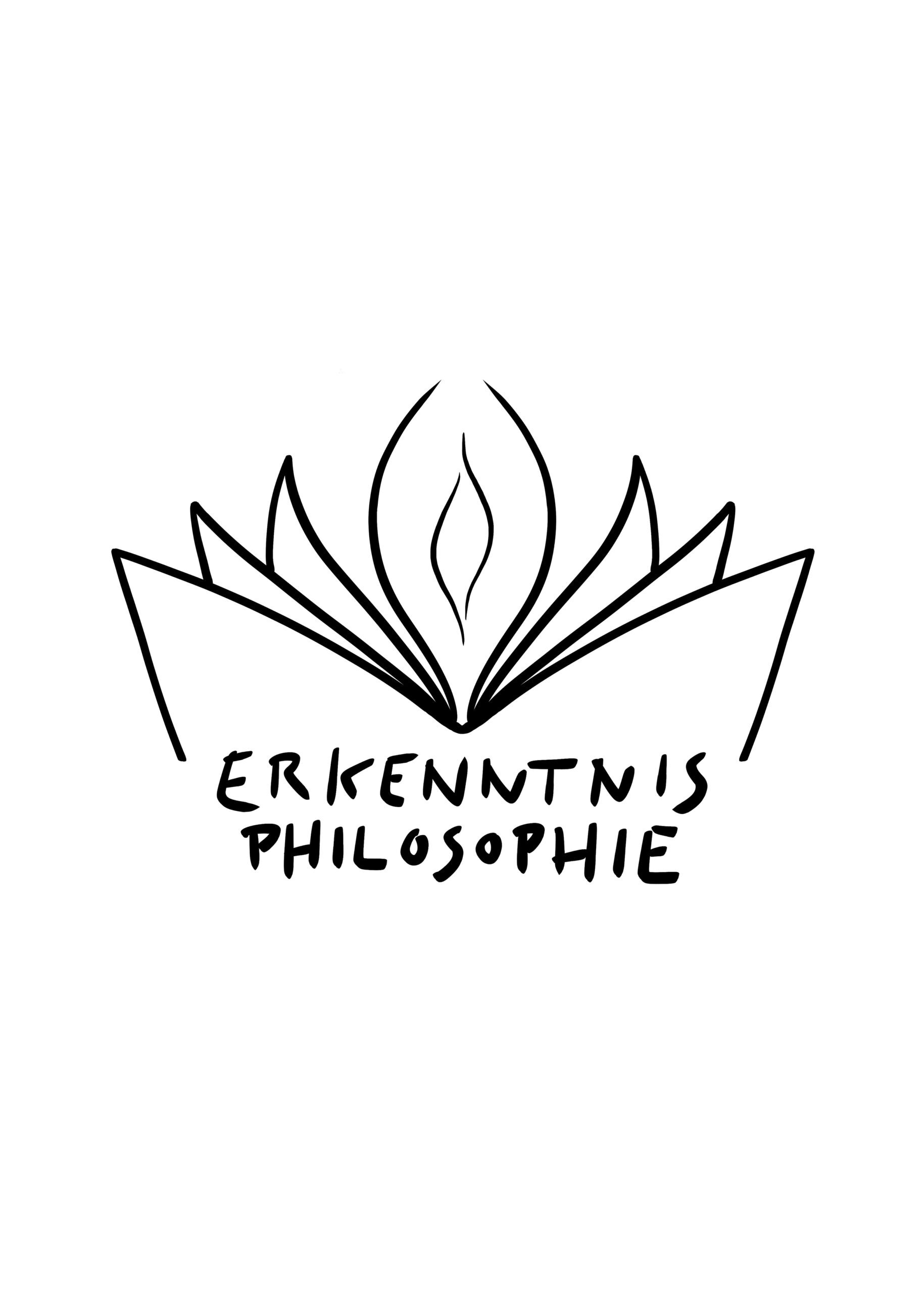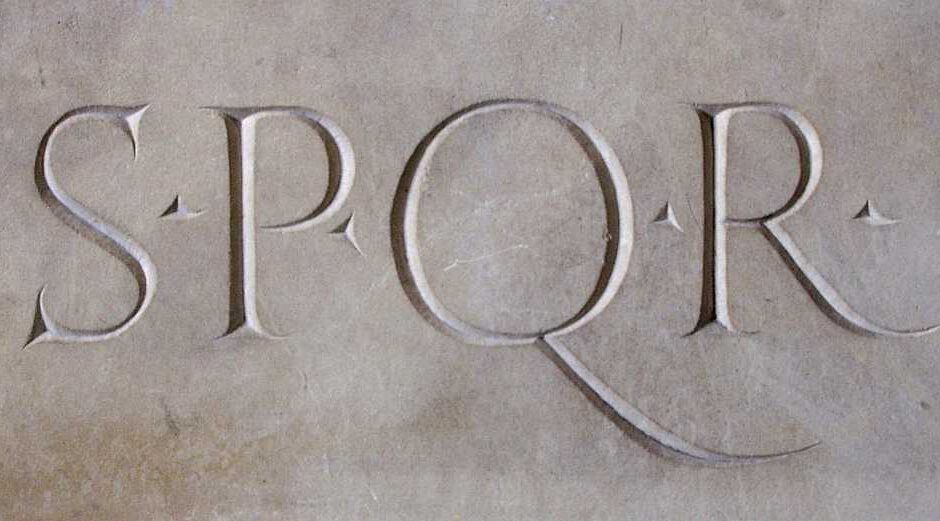Ein phänomenologischer Diskurs zwischen Rainer Dyckerhoff und Jens Jürgen Korff
Der Mannheimer Ingenieur und Philosoph Rainer Dyckerhoff empfahl 2021 in dem Buch »Erkenntnisphilosophie«, auf dem Wege einer fortschreitenden Begriffsbildung das Wesen von Phänomenen zu beschreiben und auf diese Weise wahre Aussagen über Teile der Wirklichkeit zu treffen. Er hat vier Stufen der persönlichen Begriffsbildung definiert: autorelationale Begriffe auf Stufe 1, relative Begriffe auf Stufe 2, individuelle Begriffe auf Stufe 3, wirklichkeitsgemäße Begriffe auf Stufe 4. 2025 führen Rainer Dyckerhoff und der Historiker Jens Jürgen Korff phänomenologische Diskurse über das Wesen aktueller politischer Schlagworte wie Steuern, Bürokratie und Stolz. Hier nun über die hoch umstrittenen Schlagworte Volk und Nation.
Rainer Dyckerhoff: Es mag mutig sein, aber vielleicht schaffen wir es, mit unserer hier entwickelten Methode des phänomenologischen Dialogs, auch den schwierigen Begriffen »Volk« und »Nation« auf den Grund zu gehen. Was denken Sie als Historiker? Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Worten, die so häufig in politischen Auseinandersetzungen verwendet werden?
Foto: User Lamré on sv.wikipedia, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons
Jens Jürgen Korff: Wenn ich als Historiker versuche, die Grundbegriffe »Volk« und »Nation« zu definieren und voneinander zu unterscheiden, fällt mir zunächst auf: »Volk« ist der ältere Begriff. Er war schon in der Antike sehr bekannt, z. B. in der lateinischen Floskel »Senatus Populusque Romanus« (abgekürzt SPQR, Senat und Volk von Rom). Sie bezeichnete das römische Staatswesen. Demnach bestand der römische Staat aus dem Senat, also dem Herrschaftsorgan, und dem Volk. Das Volk bildete ein Gegenstück zur Regierung oder zum Herrscher. Im griechischen Begriff »Demokratie« (Volksherrschaft) wird gesagt, dass das Volk die Herrschaft ausübt. Das Wort Volk ist oft eng verbunden mit politischer Tätigkeit und Funktion: das Volk als beratende und abstimmende Versammlung vieler Menschen oder als agierende Menschenmenge. Diese Bedeutung steckt auch in dem Wort »Wählervolk« und im Wort »Völkerrecht«, das die Rechtsbeziehungen zwischen verschiedenen Völkern bzw. ihren Staaten bezeichnet.
RD: Im Vergleich zu einem eher kleineren »Stamm« scheint ein »Volk« eine größere Gruppe von Menschen zu sein, die sich in gewisser Weise als zusammengehörig empfinden, etwa wegen gleicher Sprache, ähnlichem Aussehen, gleicher ethnischer Abstammung. Lässt sich solche Gruppe von Menschen noch genauer charakterisieren, etwa im Sinne des heutigen Ausdrucks »Zivilgesellschaft«, auch wenn der heute zumeist global gedacht wird? Mit »Volk« wäre dann zunächst einfach die Summe aller einzelnen Menschen gemeint, die sich untereinander als enger zusammengehörig empfinden als Menschen oder die Menschheit allgemein.
JJK: Ja, heute sehen wir das so. Das war nicht immer so. Die Unterscheidung zwischen „uns“, die dazugehören, und „denen“, die nicht dazugehören, gab es zwar vorher schon, aber nur auf die Religion bezogen. Erst im 19. Jahrhundert wurde das auf Eigenschaften wie die Sprache oder das Aussehen bezogen. In dieser von Naturwissenschaften und technischen Entwicklungen geprägten Zeit war es vielen Menschen in Europa wichtig, sich auf typische Eigenschaften zu berufen, die sie mit anderen Menschen gemeinsam hatten, und sich einer Gemeinschaft ähnlicher Menschen zugehörig zu fühlen, die sich von anderen Menschen unterschied. Das konnten eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Sitten und Gebräuche, gemeinsame Lieder, Sagen, Märchen, Tänze, Kleidungsmoden, Hausformen usw. sein. Die Gemeinschaft ähnlicher Menschen wurde als Volk (oder auch als Nation) bezeichnet. Der Soziologe Emerich K. Francis (1906–1994) definierte Volk in diesem Sinne als „eine jede dauerhafte, durch ein gemeinsames kulturelles Erbe gekennzeichnete, zahlreiche Verwandtschaftsverbände (kinship groups) zu einer unterscheidbaren Einheit zusammenfassende Gesamtgesellschaft“. „»Verwandtschaftsverband« soll dabei heißen: ein auf tatsächlicher oder fiktiver Abstammung beruhendes, zahlreiche Familien sowohl gleichzeitig als auch in zeitlicher Abfolge zu einer Einheit verbindendes Sozialgebilde.“ Ähnlich der Soziologe Friedrich Heckmann (*1941). Er definierte Volk als „das umfassendste ethnische Kollektiv, das durch den Glauben an eine gemeinsame Herkunft, Gemeinsamkeiten von Kultur und Geschichte sowie ein bestimmtes Identitäts- und Zusammengehörigkeitsbewusstsein gekennzeichnet ist“. Der Politikwissenschaftler Karl W. Deutsch (1912–1992) stellte in seiner Definition von »Volk« die Kommunikation in den Mittelpunkt: Dank gemeinsamer Sprache und anderer Ähnlichkeiten können sich die Menschen innerhalb eines Volkes effektiver verständigen als Menschen darüber hinaus.
RD: Kam das wirklich erst im 19. Jahrhundert?
JJK: Es wurde erst im 19. Jahrhundert so gesehen, wenn ich von Sonderfällen wie den Griechen und den Juden der Antike absehe, wo es das in Ansätzen auch schon gab. Im Europa des 15. bis 18. Jahrhunderts, auch in Indien, China und Japan waren es die Könige, die Gemeinschaften ausbildeten. Die Gemeinschaft war dadurch definiert, dass man dem gleichen König untertan war, und dass man die gleiche Religion hatte. Die anderen Eigenschaften und Ähnlichkeiten rückten in Europa tatsächlich erst im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in den Vordergrund, als im Zuge der Aufklärung, der Amerikanischen und Französischen Revolution die Bindungskraft der Monarchen nachließ und zugleich durch die Seefahrt ins Bewusstsein rückte, wie groß und vielfältig die Menschheit war. Der Historiker Dieter Langewiesche (*1943) hat auf Forschungen zum Mittelalter hingewiesen: Danach folgt die Ethnogenese, die Entstehung der Völker, der Herrschaftsbildung und nicht umgekehrt. Völker entstehen demnach in Staaten, sie sind jünger als diese. Die Vorstellung, das Volk sei „ewig“ und werde erst im Laufe seiner Entwicklung eine Nation, die sich einen Staat schaffe, ist also ein Mythos.
In Deutschland war das Bedürfnis nach volkstümlichen Gemeinsamkeiten besonders stark ausgeprägt, weil Deutschland von 1648 bis 1871 kein Staat war, sondern in zahlreiche Kleinstaaten zersplittert. Deshalb trat das Volk mit seinen kulturellen Gemeinsamkeiten an die Stelle des fehlenden Staates.
RD: Das ist ein guter Hinweis. Ist da auch die Quelle für den extremen deutschen Nationalismus zu suchen?
JJK: Ja. Konservative und später faschistische Kreise vor allem in Deutschland versuchten ab dem späten 19. Jahrhundert, das Wort »Volk« mit einem Mythos aufzuladen und zu einem Heiligtum zu verklären, das in der Naziparole »Ein Volk – Ein Reich – Ein Führer« seinen Höhepunkt fand. Damit verbunden war die Vorstellung, das deutsche Volk sei von Gott oder einer göttlichen »Vorsehung« auserwählt und zum »Herrenvolk« berufen, also dazu, über alle anderen Völker der Erde zu herrschen. Die Anhänger dieser religionsartigen Vorstellung bezeichneten sich selbst als »Völkische«. Sie betrachteten das Blut als stofflichen Träger des Mythos und forderten deshalb, das »deutsche Blut« müsse rein gehalten werden. Das Blut stand für die Gene; gemeint war also, dass »reinrassige« Deutsche, von den Nazis irreführend »Arier« genannt, sich nicht mit Menschen anderer Völker oder »Rassen« paaren und gemeinsame Nachkommen haben dürften. Die Nazis übernahmen die Vorstellung eines von Gott »auserwählten Volkes« merkwürdigerweise von den Juden. Ihr besonderer Hass auf die Juden hängt mit der Konkurrenz um diese angemaßte, herausgehobene Position zusammen. Allerdings war die jüdische Vorstellung vom »auserwählten Volk«, anders als die deutsche, nie mit dem Gedanken verbunden gewesen, die Juden hätten das Recht, über andere Völker zu herrschen.
RD: Und die »Nation«? Was war und ist da anders?
JJK: Das Wort »Nation« hat Bedeutungen, die sich teilweise mit denen des Wortes »Volk« vermischt haben. Es ist später entstanden, seit dem 14. Jahrhundert im Deutschen vertreten, abgeleitet vom lateinischen Wort »natio«. Das bezeichnete sinngemäß eine Geburtsgemeinschaft, also eine Gruppe von Menschen, die von ihrer Geburt her gemeinsame Eigenschaften haben. Das konnte eine Sippe sein, also eine erweiterte Verwandtschaft, aber auch ein Volk oder Volksstamm. Im Römischen Reich bezeichnete man vor allem fremde Völker, die innerhalb des Reiches lebten, aber kein römisches Bürgerrecht besaßen, als «nationes« – sozusagen die dortigen „Eingeborenen“. Aus diesem Sinn heraus entstand im 14. und 15. Jahrhundert an deutschen Universitäten der Sprachgebrauch, verschiedene Landsmannschaften der Studenten, teilweise recht willkürlich, zu «Nationen« zusammenzufassen.
Das Wort »Nation« ist abstrakter und problematischer als das Wort »Volk«. Schon der Sprachgebrauch an den Universitäten des 14. Jahrhunderts setzte sich über den ursprünglichen lateinischen Wortsinn »Geburtsgemeinschaft« hinweg. Das Wort »Nation« hängt in seiner modernen Bedeutung mit der Französischen Revolution von 1789 zusammen: Damals erklärten sich die Abgeordneten des Dritten Standes, also des Bürgertums, zur »Nationalversammlung«. Sie erhoben den Anspruch, für die ganze französische Nation zu sprechen, und sie schlossen den Adel und den Klerus aus der Nation aus. Seitdem war Nation ein Begriff des Bürgertums und mit den Bürgerrechten verknüpft. Davon wollten sich die »Völkischen« in Deutschland und später die Nazis heftig absetzen und setzten ihren Volksbegriff dagegen. Die aus der Biologie abgeleiteten Vorstellungen der »Völkischen«, das Gerede vom Blut und seiner Reinheit, war mit dem Wort »Volk« verknüpft und nicht mit dem Wort »Nation«.
RD: Lässt sich daraus schließen, dass der Gebrauch des Wortes »Nation« – entgegen seinem ursprünglichen lateinischen Wortstamm – im Laufe der Geschichte eher zu einem Staatsbegriff als zu einem Volksbegriff neigte?
JJK: Ja. Denn die Nation bildete, anders als das Volk im altrömischen Sinne, keinen Gegenpol zur Regierung, zur herrschenden Schicht oder zum Monarchen. Vielmehr wurde die Nation als Nationalstaat vor allem im 19. Jahrhundert meist mit einem Staat und also auch mit der Regierung des Staates gleichgesetzt. Allerdings gab es beim Wort »Volk« die gleiche Tendenz, es vor allem als »Staatsvolk« zu sehen.
RD: Aber in der Französischen Revolution gab es doch, wie Sie eben sagten, eine bürgerliche Nation, aus der die Adligen ausgeschlossen wurden.
JJK: Ja, es ist ziemlich widersprüchlich. Im frühen 19. Jahrhundert wurde noch so gedacht, im späten dann ganz anders. Da war die Nation auf einmal etwas Allumfassendes. Das hing mit nationalen Einigungs- und Sezessionsprozessen zusammen, etwa in Italien, Deutschland, Österreich-Ungarn und Polen. Italien und Deutschland waren in Fürstentümer zersplittert, deren Bevölkerungen sich dank gemeinsamer Sprache und Kultur zusammengehörig fühlten und deren Wirtschaft auf größere, zunächst nationale Märkte orientiert war. Umgekehrt im »Vielvölkerstaat« Österreich-Ungarn: Dort entstanden in Ungarn, Norditalien, Böhmen (Tschechien) und anderswo Bestrebungen, den übernationalen Staat zu verlassen und eigene Nationalstaaten zu gründen. Vorbild war Griechenland, das sich schon 1824-30 erfolgreich aus dem Osmanischen Reich hatte lösen können. Polen war Ende des 18. Jahrhunderts auf drei Nachbarstaaten: Russland, Preußen und Österreich-Ungarn, aufgeteilt worden, und viele Polen, oder das polnische Volk, wollten wieder in einem polnischen Nationalstaat zusammenkommen. Man nannte diese Probleme jeweils »die nationale Frage«. Die Betroffenen empfanden eine Differenz zwischen den Staatsgebieten, denen sie angehörten, und einem idealen Staatsgebiet. Dieses Ideal orientierte sich meist an den Vorbildern Frankreich und Großbritannien, vielleicht auch Russland. In diesen Ländern waren schon im 17. Jahrhundert Staaten entstanden, die, zumindest von außen betrachtet, wie einheitliche Nationalstaaten aussahen: Staaten also, deren Staatsvölker zugleich Völker waren, die sich sprachlich, kulturell, wirtschaftlich und religiös verbunden fühlten. Inwieweit das bei Engländern, Schotten und Walisern, bei Parisern, Bretonen, Basken, Okzitaniern und Korsen wirklich der Fall war, steht auf einem anderen Blatt.
RD: Eine Nation scheint stets mit einem bestimmten Gebiet, praktisch einem angestrebten oder verwirklichten Staatsgebiet, verknüpft zu sein. Oder wäre eine Nation ohne Gebiet denkbar?
JJK: Nein, das wäre nicht denkbar. Eine Nation ist tatsächlich immer auf ein Gebiet bezogen, viel stärker als ein Volk. Und sie ist auf einen Staat bezogen, der entweder schon besteht oder angestrebt wird. Allerdings gab es im 19. Jahrhundert auch die Ansicht, ein Volk ohne Verfassung, also ohne Staat, sei kein richtiges Volk. Daher das Wort »Staatsvolk«. Der erwähnte Soziologe Francis setzte es mit dem altgriechischen Wort Demos gleich und unterschied zwischen Demos und Ethnos, also zwischen Staatsvolk und Abstammungsvolk. Der Soziologe M. Rainer Lepsius (1928–2014) griff dieses Spannungsverhältnis auf als „Basis für eine Zivilgesellschaft demokratischer Selbstlegitimation“: Setze man Demos als Träger der politischen Souveränität mit einem spezifischen Ethnos gleich, führe das zur Unterdrückung oder Zwangsassimilation ethnischer, kultureller, religiöser oder sozioökonomischer Minderheiten. So etwas finden wir in Apartheidstaaten. Der Status des Staatsbürgers ist nach Lepsius in seinem Ursprung naturrechtlich und individualistisch definiert und gilt für alle gleich. Er darf nicht an materielle Eigenschaften geknüpft werden, die den durch sie definierten Bevölkerungsteilen unterschiedliche Partizipationsrechte zuteilen. Der Soziologe Michael Bommes (1954–2010) definierte Ethnien als „Völker ohne Staaten“, wohingegen Nationen „Völker mit Staaten“ seien.
RD: Ist das Wort »Nationalstaat« dann nicht eigentlich doppelt gemoppelt?
JJK: Ja, in der Tat.
RD: Ich versuche, ein paar Punkte zusammenzufassen. Ich glaube, wir haben eine recht gute Sortierung in unserem Thema erreichen können, nämlich Kernpunkte der Begriffe Volk, Staat und Nation, und zwar „individuelle Begriffe“ von diesen; das heißt, es sind unbedingt zutreffende Aspekte, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit bzw. abschließende wahre Definitionen (das wären dann „wirklichkeitsgemäße Begriffe“).
- »Volk« ist zunächst eine größere Menge bzw. Summe von Menschen mit bestimmten gemeinsamen Eigenschaften wie insbesondere gleicher Sprache, ähnlichem Aussehen, überwiegend gemeinsamer ethnischer Abstammung und ähnlichen kulturellen Werten und Äußerungsformen.
- »Staat« ist im Vergleich zu »Volk« etwas qualitativ anderes, nämlich ein Rechtsgebiet, also ein Stück Land, in dem idealerweise ein weitgehend gleiches Recht gilt für alle, die darin leben, egal welchen Volkes bzw. welcher Abstammung. Von Ausnahmen wie Apartheid-Staaten abgesehen, die sich ausdrücklich nicht an diese Grundregel der Allgemeinen Menschenrechte halten.
- Wenn mit dem Begriff »Volk« aber »das Völkische« betont wird, so geht damit gewöhnlich eine Wertung einher, eine Überhöhung des eigenen und eine Abwertung anderer Völker. Das eigene Volk wird quasi-religiös überhöht.
- »Nation« ist von seinem lateinischen Wortstamm »natio« her mit Geburtsabstammung und vielleicht auch mit Geburtsrecht verbunden; in seinem Gebrauch ist es aber ein vergleichsweise uneindeutiger Begriff, wie die Geschichte zeigt. Nation ist in jedem Falle mit einem Lebens- bzw. Rechtsgebiet verknüpft, also mit einem Staat. Dabei kommt die Frage der Staatsbürgerschaft ins Spiel, also: Wer ist Staatsbürger mit allen Bürgerrechten und wer nicht?
- Der Begriff »Nationalstaat« betont in der Regel den ursprünglichen lateinischen Sinn von »natio« als Geburtsgemeinschaft, also eine Art Geburtsrecht. Er tritt dabei in zwei unterschiedlichen Varianten auf: entweder als »Volksstaat«, der ein eigenes Gebiet für das eigene Volk beansprucht,
oder nach dem Geburtsortsprinzip, wie es z.B. in der Verfassung der USA gilt: Danach sind alle im Land Geborenen automatisch legitime Staatsbürger – egal welcher ethnischen Abstammung.