Die menschliche Erkenntnisfähigkeit
Dieses Buch beschreibt auf neuartige Weise die Grundlagen, die Funktion und das Potential unserer menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Wir alle wenden diese ja stets und ganz selbstverständlich an, mit mehr oder weniger Erfolg, und bereits von Kindesbeinen an. Darzustellen, wie das genau geschieht, das ist das Kernthema dieses Buches.
(Diese Leseprobe stellt eine neue erste Einleitung zum Buch dar, also sozusagen Kap. 1.0)
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis herunterladen (PDF)
Dass wir zu Erkenntnissen gelangen können, beruht auf zwei Grundfähigkeiten, die wir von Geburt an haben und von da an stets automatisch anwenden: Es sind einerseits unsere Wahrnehmungsfähigkeit mit allen uns zur Verfügung stehenden Sinnen, und andererseits unsere Denkfähigkeit (inklusive unserem Gedächtnis). Diese Fähigkeiten gebrauchen wir, auch ohne explizit zu wissen, wie wir das eigentlich machen. Auch unser Denken funktioniert von klein auf automatisch in uns – ehe wir überhaupt darüber nachdenken können, und schon vor jedem intellektuellen, strategischen oder wissenschaftlichen Denken, das wir mit zunehmendem Alter erlernen können.
Diese beiden Grundfähigkeiten, die Wahrnehmung und das Denken, werden in Kapitel 2 und 3 zunächst separat beschrieben. In Kapitel 4 und 5 wird dann gezeigt, wie das Zusammenspiel der beiden Fähigkeiten uns ermöglicht, zu Erfahrungen zu gelangen, mit diesen umzugehen und darauf aufbauend Erkenntnisse zu gewinnen. Ein Verständnis davon, was in der Welt geschieht, gewinnen wir, indem wir uns Begriffe von den Dingen und Geschehnissen auf der Basis unserer Erfahrungen bilden.
Um genau zu beschreiben und zu analysieren, was bei der Wahrnehmung und beim Denken passiert, wird in diesem Buch die phänomenologische Methode angewandt. Diese hat der Philosoph Edmund Husserl zu Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt. Er wollte damit ein Gegengewicht zur vorherrschenden Art der Philosophie im 19. Jahrhundert schaffen. Die Grundlage der phänomenologischen Methode ist die Einsicht, dass der Ursprung und die Basis für alle unsere Erkenntnisbemühungen stets unmittelbar gegebene Erscheinungen sind. Husserl nannte sie Phänomene. Phänomenist jeweils das, was wir mittels unserer Sinnesorgane unmittelbar wahrnehmen können, oder genauer formuliert das, was mittels der Sinnesorgane unmittelbar unserer Wahrnehmungsfähigkeit vorliegt. Das können Geräusche sein, so wie unser Ohr sie hört, oder Formen und Farben, so wie wir sie vor Augen haben, ein Wahrnehmungsbild oder Teile davon, die wir gerade anschauen.
Husserl zeigte in seiner Phänomenologie auf, dass wir zu wahren Erkenntnissen, die der Realität genügen, nur dann gelangen können, wenn wir mit unseren Erkenntnisbemühungen und unserem Forschungsdrang direkt und genau auf den wahrgenommenen Phänomenen aufbauen. Im Rahmen unseres wahrnehmenden Bewusstseins geht es nämlich um eine gewisse Faktizität der Wahrnehmung; und diese ist sehr ernst und genau zu nehmen, bevor sich überhaupt das eigentliche Erkenntnisthema stellt.
Die phänomenologische Methode wird in diesem Buch angewandt, um unserer Fähigkeit zur Erkenntnis und dem Prozess der Erkenntnis genau auf die Spur zu kommen. Hier wird keine Theorie aufgestellt – also nicht eine „Erkenntnistheorie“, nicht eine weitere Hypothese oder Vermutung über etwas, das eigentlich unerkennbar sei oder im Kern noch unbekannt wäre. Vielmehr zeigt dieses Buch einen neuen rein phänomenologischen Zugang zur Erkenntnisthematik auf, der anders ist als bisher üblich in der 2500-jährigen Geschichte der klassischen „Wahrheits-“ und „Erkenntnistheorien“. Diese vertreten sehr unterschiedliche und konträre, also einander widersprechende und sich gegenseitig ausschließende Positionen. Zudem sind sie in der Regel sehr umfangreich und kompliziert bis hin zu vollkommen abstrakt anmutend. Sie leiden nämlich unter einer prinzipiellen philosophischen „Theorie“-Problematik: Sie formulieren und beruhen auf Annahmen und Voraussetzungen – philosophisch genannt „Axiome“ – , die von Theorie zu Theorie sehr unterschiedlich sind und oft auch recht subjektiv erscheinen. Genau das und die darauf aufbauenden Denkbewegungen führen zu den großen Unterschieden dieser Theorien und sind folglich Anlass zu ständigen intern-philosophischen Diskussionen. Ein Beispiel für solche Erkenntnistheorien ist die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant, von der sich dieses Buch begründet abgrenzt. Mit seinem neuartigen Ansatz zeigt es die Möglichkeit einer unmittelbar praxisrelevanten Philosophie der Erkenntnis auf. Und es will auch ein Impuls sein für eine mögliche und mutmaßlich notwendige disruptive Wende in der philosophischen Behandlung der Erkenntnisthematik.
Lange vor Kant, im 13. Jahrhundert, hatte der Theologe und Philosoph Thomas von Aquin eine genial einfache und daher auch berühmt gewordene Allgemein-Formel für das Erkenntnis- und Wahrheitsproblem gefunden: veritas est adaequatio intellectus et rei. In einer möglichst allgemeingültigen Übersetzung aus dem Lateinischen: Wahrheit ist die Angleichung von menschlichem Verständnis und dem Sachverhalt. Entlang dieser Formel entwickelt sich in diesem Buch die Beschreibung der Erkenntnisthematik. Bei Thomas von Aquin blieb allerdings zunächst offen, wie wir wissen können, was der Sachverhalt ist: Wie kommen Wissen und Sachverhalt zusammen? Doch mit der hier angewandten phänomenologische Methode, und in Kombination mit einem weiteren Schlüsselelement, konnte eine neue und wirkliche Lösung der Thomas’schen Gleichung gefunden werden, die hiermit veröffentlicht wird.
Der erste Teil des Buches ist rein philosophisch gehalten und folgt der phänomenologischen Methode. Er behandelt die Frage „Wie funktioniert Erkenntnis“ im Grunde. Dabei zeigt sich, wie unsere Erkenntnisfähigkeit auf der Erfahrungs- und Lernfähigkeit der Tierwelt aufbaut. Und schließlich zeigt sich, dass mit phänomenologischen Mitteln ein grundlegendes Verständnis unserer Erfahrungs- und Erkenntnisfähigkeit möglich ist, das heißt, dass die Erkenntnisproblematik auf diese Weise prinzipiell in den Griff zu bekommen ist.
Im zweiten Teil geht es darum, wie wir das Potential unserer Erkenntnisfähigkeit immer genauer, immer bewusster und umfangreicher erschließen können. Dabei werden auch einzelne tiefenpsychologische und spirituelle Aspekte betrachtet, die über die Gepflogenheiten der traditionellen Philosophie hinausgehen. Es zeigt sich, wie elementar wichtig diese Aspekte sind, um den Prozess der menschlichen Erkenntnisgewinnung zu verstehen. Schließlich wird insbesondere unsere menschliche Fähigkeit zu Empathie und Mitgefühl einbezogen: unsere Fähigkeit zu einem „grenzenlosen Mitgefühl“, zu einem verstehenden Miterleben oder einem miterlebenden Verständnis mit den Dingen und Phänomenen der Welt. Dieser Aspekt stammt aus dem säkularen Zen-Buddhismus. Und er liefert das fehlende Glied in der Kette, die Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert zu schmieden begonnen hat. Denn unser verstehendes Miterleben mit der zu erkennenden Sache fördert und bewirkt die Angleichung (adaequatio) unseres Verständnisses (intellectus) an den Sachverhalt (res). Das verstehende Miterleben stellt eine direkte und lebendige Vermittlung her; es ist die reale und konkrete Brücke zwischen uns selbst und der zu erkennenden Sache. Und es ist die Lösung der Thomas-Gleichung, sobald es die geforderte Angleichung (adaequatio) ganz erfüllen kann. Die Thomas-Formel entwickelt sich damit zu folgender Gestalt weiter: Wahrheit (veritas) ist – vermittelt durch ein verstehendes Miterleben (adaequatio) – das miterlebende Verständnis unseres Geistes (intellectus) mit dem Sachverhalt beziehungsweise mit der Sache-selbst (res).
Das bedeutet, dass unsere Erkenntnisfähigkeit unter Einbezug unserer Fähigkeit zu Empathie und Mitgefühl im Grunde eine implizite soziale und ethische Dimension hat. Perspektivisch kann also bei Fragen und Themen, bei denen uns eine in dieser Weise gegründete Erkenntnisqualität gelingt, eine zusätzliche, dem Menschen von außen aufgesetzte moralische Diktion entbehrlich werden. Das heißt, die Wahrheit macht uns frei.
Als sich diese Resultate zeigten, da fiel der Entschluss, dieses Buch zu schreiben.
- Zur philosophischen Problematik der Wahrheit
- Zum Verhältnis von Wirklichkeit und Wahrheit
- Die Schlüsselbegriffe des Buches
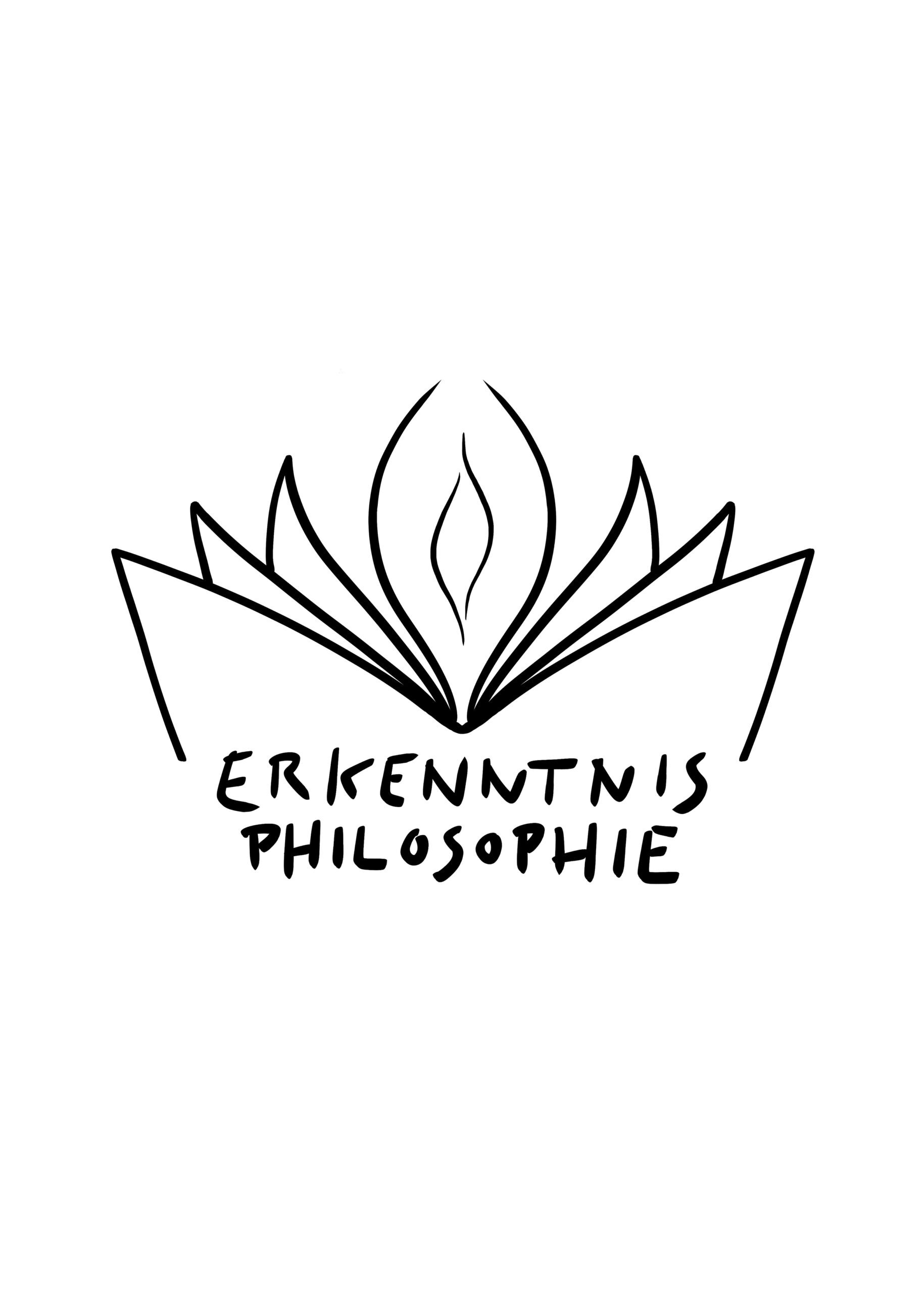

Erkenntnis liegt ein Ereignis zu Grunde – mit der äusseren Sinnerfassung, sehen, hören, riechen und schmecken – ein Bild ergibt – ein Gedanke – sich daran erinnern. Ein Fotoalbum des Lebens – einzigartig und individualistisch – nur im Dialog – werden Konturen wahrhaftig durch Wiederholung sichtbar gemacht. REFLEXION ist ein Hilfsmittel im Nachdenken.